WTO-Richtlinien als notwendiges Übel
Um sich stark abzusichern, gestalten Institutionen Ausschreibungen häufig unnötig komplex. Die daraus resultierende Starre produziert Probleme für Ausschreiber und Lieferanten. Letztere plädieren deshalb für mehr Dialog und Agiliät.
 Nur durch Austausch kann ein Softwareprojekt sinnvoll beschafft werden.
Nur durch Austausch kann ein Softwareprojekt sinnvoll beschafft werden.
Softwarehersteller, die für die öffentliche Hand arbeiten, müssen sich wohl oder übel mit dem Thema WTO herumschlagen. swiss made software sprach mit verschiedenen Schweizer Softwareanbietern darüber. Das Thema ist brisant – das zeigt die Tatsache, dass es die Befragten bevorzugt haben, anonym zu bleiben. Nicht, dass sie nicht zu ihren Aussagen stehen würden – doch niemand möchte auf der inoffiziellen Blacklist der Verwaltungen stehen.
Öffentliche Beschaffungen für Güter und Dienstleistungen mit einem geschätzten Wert von mehr als 230'000 Franken müssen in der Regel ausgeschrieben werden. Weil die Erstellung von Ausschreibungsunterlagen und die Einreichung einer Offerte mehrere tausend Franken kosten können, lohnt sich bei kleinen Projekten der Aufwand nicht. Deshalb fordern Softwareanbieter schon seit Langem eine Anhebung dieser Grenze auf mindestens eine halbe oder eine Million Franken. Doch dieser Wunsch wird vorerst unerfüllt bleiben.
In den letzten Jahren wurden innerhalb der Welthandelsorganisation (WTO) neue Regeln erarbeitet. In der Schweiz wird das Abkommen nächstes Jahr ins Parlament kommen. Mit einer Ratifizierung ist frühestens 2016 zu rechnen. In den Verhandlungen hat die Schweiz zwar auf eine Erhöhung der Schwelle gepocht, doch dem Vernehmen nach hiess es vor allem sie Berater engagieren, die dann hoch detaillierte Unterlagen erstellen. Doch dies sei nicht der richtige Weg. «Im Nachhinein stellt sich immer heraus, dass viele Anforderungen, die definiert wurden, gar nicht mehr gebraucht werden.»Die Qualität von Pflichtenheft und Ausschreibungskatalog sei oftmals zum Haare raufen, sagt einer, der sich mit Softwarebeschaffungen auskennt. Es komme auch immer wieder vor, dass quasi Datenblätter von Anbietern kopiert werden, um so eine Art Scheinausschreibung zu machen. Allen Beteiligten sei dann klar, dass nur ein einziger Anbieter den Auftrag bekommen könne. Dabei sollte es im Interesse der öffentlichen Hand sein, dass eine Konkurrenzsituation unter den Lieferanten besteht, damit tiefere Preise erzielt werden können.Ein grundsätzliches Merkmal von Software ist, dass sich die Technologie rasant verändert und die Komplexität laufend zunimmt. Eine Ausschreibung ist aber oft ein langwieriges Verfahren. So kann es vorkommen, dass zwischen der Erstellung des Pflichtenhefts und dem Zuschlag Jahre vergehen, bis das Projekt beginnen kann. Ob die anfänglich gewünschte Technologie dann noch aktuell ist, sei dahingestellt.Personalverleih ist verpönt. Doch oftmals vergibt die Bedarfsstelle gar kein konkretes Projekt, sondern schreibt ganz einfach Personalressourcen aus. Diese Praxis steht ebenfalls in der Kritik, denn sie birgt Gefahren: Der Bund kann beim Scheitern eines Projekts nicht den Lieferanten verantwortlich machen, da kein Werkvertrag besteht. Dabei geraten just solche Projekte in Schieflage, die vollgepackt sind mit Leihpersonal. Grund: Niemand fühlt sich wirklich verantwortlich, seitens USA: «No way, sonst schliessen wir die Grenzen!» Beobachter rechnen nicht damit, dass sich mittelfristig an der Schwelle rütteln lässt.
Problematische Ausschreibungen
Doch die Schwelle ist gar nicht das grösste Problem bei WTO-Ausschreibungen. Kritisiert wird vielmehr die Art und Weise, wie Ausschreibungen durchgeführt werden. Ein Dorn im Auge vieler Softwarehersteller ist der oftmals hohe Detailgrad. «Es bringt nichts, alles auf Papier zu bringen und dann schriftlich Informationen auszutauschen. Am Schluss versteht kein Mensch mehr, worum es geht», sagt ein Geschäftsleitungsmitglied eines Softwareanbieters.
In der Branche spricht man von unnötigem Formalismus: Beglaubigte Handelsregisterauszüge, Bankgarantien oder das Vorweisen von zahlreichen Referenzen – «das ist ein Irrwitz», sagt ein Vertreter eines Schweizer Softwareherstellers. Diese Absicherungen haben freilich mit der medialen Aufmerksamkeit nach den vielen Skandalen in den letzen Jahren zu tun. Weil niemand Fehler machen will, wird alles bis ins Detail vordefiniert. Doch für die meisten Akteure aus der Softwarebranche werden Ausschreibungen so zu einer Plage.
«Heute sind Beschaffungen sehr wasserfallorientiert: Pflichtenhefterstellung, Ausschreibung, Verfahren und Zuschlag – und am Schluss sind alle unglücklich», sagt ein Kenner. Bund, Kantone oder Kommunen seien bei Ausschreibungen häufig überfordert. «WTO ist sinnvoll, wenn ich eine Brücke bauen will oder Bleistifte brauche – aber nicht bei so etwas Komplexem wie einem Softwareprojekt.» Weil die Institutionen nicht durchblicken, müssen sie Berater engagieren, die dann hochdetaillierte Unterlagen erstellen. Doch dies sei nicht der richtige Weg. «Im Nachhinein stellt sich immer heraus, dass viele Anforderungen, die definiert wurden, gar nicht mehr gebraucht werden.»
Die Qualität von Pflichtenheft und Ausschreibungskatalog sei oftmals zum Haare raufen, sagt einer, der sich mit Softwarebeschaffungen auskennt. Es komme auch immer wieder vor, dass quasi Datenblätter von Anbietern kopiert werden, um so eine Art Scheinausschreibung zu machen. Allen Beteiligten sei dann klar, dass nur ein einziger Anbieter den Auftrag bekommen könne. Dabei sollte es im Interesse der öffentlichen Hand sein, dass eine Konkurrenzsituation unter den Lieferanten besteht, damit tiefere Preise erzielt werden können.
Ein grundsätzliches Merkmal von Software ist, dass sich die Technologie rasant verändert und die Komplexität laufend zunimmt. Eine Ausschreibung ist aber oft ein langwieriges Verfahren. So kann es vorkommen, dass zwischen der Erstellung des Pflichtenhefts und dem Zuschlag Jahre vergehen, bis das Projekt beginnen kann. Ob die anfänglich gewünschte Technologie dann noch aktuell ist, sei dahingestellt.
Personalverleih ist verpönt
Doch oftmals vergibt die Bedarfsstelle gar kein konkretes Projekt, sondern schreibt ganz einfach Personalressourcen aus. Diese Praxis steht ebenfalls in der Kritik, denn sie birgt Gefahren: Der Bund kann beim Scheitern eines Projekts nicht den Lieferanten verantwortlich machen, da kein Werkvertrag besteht. Dabei geraten just solche Projekte in Schieflage, die vollgepackt sind mit Leihpersonal. Grund: Niemand fühlt sich wirklich verantwortlich, das Personal wechselt öfter und ist auch nicht besonders motiviert. Die Alternative sind Werkverträge mit klarer Verantwortung beim Lieferanten. «Wir bevorzugen konkrete Projekte, nicht nur aus ökonomischer Überlegung, sondern weil so unsere Entwickler motivierter sind», sagt ein Zürcher Softwarehersteller. «Softwareentwickler wollen Resultate zeigen und stolz sein auf ihr Produkt. Beim Personalverleih verpufft die Leistung.» Ein Anderer sagt: «Bodyleasing macht mich wütend, so geht der ganze Mehrwert einer Firma verloren. Wir wollen lieber die Verantwortung übernehmen.»
Agile Beschaffung und Dialog
Was ist also die Alternative zu komplexen Ausschreibungen und problematischem Bodyleasing? Viele aus der Szene plädieren für mehr Agilität bei Beschaffungen. Soll heissen: Die ausschreibende Stelle weiss, was sie braucht, schreibt aber nicht alles im Detail aus, sondern definiert einen groben Rahmen. Die Vergabestelle soll eine Ahnung davon haben, was benötigt wird, jedoch soll sie bereit sein, das Projekt auf dem Weg laufend anzupassen. Agile Beschaffung ist schon heute mit den geltenden WTO-Vorschriften möglich. Die neuen Regeln werden der agilen Beschaffung zusätzlichen Schub verleihen, so die Hoffnung der Softwarebranche.
Ein weiterer Schritt zur Reduzierung der Probleme in der öffentlichen Beschaffung ist die verstärkte Anwendung des Dialogverfahrens. Viele Softwarehersteller plädieren dafür, dass alle Kandidaten eines Projekts an einem runden Tisch mit dem Auftraggeber diskutieren. Das beim Bund für Beschaffungen zuständige Bundesamt für Bauten und Logistik bevorzugt im Dialogverfahren allerdings Zweiergespräche zwischen Bedarfsstelle und Kandidat: «Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Unternehmen ihre Innovationen nicht vor den Mitbewerbern präsentieren wollen. Dies aus Sorge, dass ihre besten Lösungen von der Konkurrenz kopiert oder übernommen werden könnten», heisst es beim BBL.
Einige Softwareanbieter glauben allerdings, dass alle Beteiligten von solchen Round Tables profitieren würden. «Die Konkurrenz hört zu, das stimmt. Aber dafür diskutiert man eingehend über das Projekt und man kommt so zu einer realistischen Einschätzung», sagt einer. Wie in der Baubranche plädiert er zudem dafür, dass Softwareanbieter für aufwendige Offerten finanziell entschädigt werden. Er ist überzeugt, dass man mit solchen Round Tables das Dialogverfahren auch bei kleinen Projekten anwenden könne. «Wir wollen reden, uns mit dem Auftraggeber austauschen. Nur so kann sinnvoll ein Softwareprojekt beschafft werden.»
Die Entwicklung einer umfangreichen Softwarelösung ist eine hochintellektuelle Leistung, vergleichbar mit einem Hausbau. Wer ein solches «Haus» für die öffentliche Hand erstellen will, muss WTO als notwendiges Übel akzeptieren. Immerhin, sagt einer der befragten Softwareanbieter, habe beim Bund in letzter Zeit durchaus eine gewisse Professionalisierung stattgefunden. Agile Beschaffung sei in Bundesbern kein Fremdwort mehr. Dasselbe könne man von Kantonen und Kommunen aber nicht behaupten.
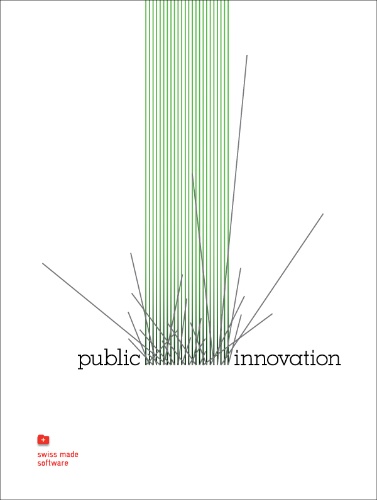
mehr davon...
...gibt es im neuen swiss-made-software-Buch "Public Innovation". Erhältlich als Print und eBook hier.