Interview Daniel Goristidi: "Das Know-how liegt nicht im Code-Schreiben"
1968 als Spin-off von Grande Dixence und der Société Générale pour l’Industrie (SGI) gegründet, ist Elca heute mit über 600 Mitarbeitenden der grösste Schweizer Informatikdienstleister. Als CEO und Hauptaktionär überblickt Daniel Gorostidi damit über 45 Jahre Schweizer Informatikgeschichte. Diese verlief alles andere als geradlinig.

- Swiss made software: Bis in die achtziger Jahre war Elca mit rund 15 Mitarbeitenden ein kleiner Anbieter. Gab der Markt nicht mehr her?
-
Daniel Gorostidi: Doch, aber ELCA hatte einen klaren Fokus und unsere Aktionäre wollten nicht, dass Elca wächst.
- Was änderte sich dann?
-
Anfang der 90er Jahre waren wir etwas über 20 Ingenieure, zwei Jahre später bereits 100. Dies war vor allem unserem neuen Kunden und Aktionär zu verdanken, den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB). Die SBB stellten zwei Bedingungen: Erstens mussten wir 50 Prozent unserer Aufträge mit Drittaufträgen generieren und zweitens mussten wir nach dem Fixpreismodell liefern. So lernten wir, wie man Projekte richtig managt. Die SBB waren aber auch aus einem weiteren Grund ein äusserst wichtiger und herausfordernder Kunde. Dort begann man schon sehr früh auch in Indien zu entwickeln. Das sorgte natürlich für zusätzlichen Druck.
- Wie konnten Sie dem standhalten?
-
Die erste Projektausschreibung hatten wir noch gewonnen, die zweite hingegen verloren wir. Bei der dritten boten wir zwar zum selben Preis an. Dennoch wollten die SBB den indischen Mitbewerber verpflichten. Und so griff ich zum Telefon, um nach dem Grund zu fragen. Die Erklärung der SBB war aber letztlich einsichtig. Wir hatten zwar denselben Preis, aber dafür hätten wir ziemlich strampeln müssen, während es bei den Indern noch einiges an Luft gab. Obwohl ich die SBB letztlich von unserem Angebot überzeugen konnte, war mir klar geworden, dass ich etwas unternehmen musste.
- Und das hiess, in ein Flugzeug zu steigen?
-
Eben nicht. Es brauchte ganze vier Jahre, bis ich meine Shareholder von der Idee überzeugen konnte, in ein Offshore-Enwicklungsmodell einzusteigen. Letztlich flog ich aber nicht nach Indien, sondern nach Vietnam. 1996 hatten wir in Saigon vier Ingenieure angeheuert und brachten sie in die Schweiz. Ein halbes Jahr lang habe ich sie in meinem Haus beherbergt. Dies gab mir die Chance, die vietnamesische Mentalität kennenzulernen. Nach einem Jahr schickte ich sie zurück, und wir fingen an mit ihnen zu arbeiten.
- Zu diesem Zeitpunkt waren Sie immer noch angestellt. Wie kam es zum Management-Buy-out?
-
Ende der 90er Jahre zählte Elca 150 Mitarbeitende. Damit wurden wir zu gross für einige unserer Teilhaber und Partner, weshalb sie aussteigen wollten. So entschloss ich mich, ihren Anteil zu kaufen.
- Seit Sie der Patron von Elca sind, ist das Unternehmen auf über 600 Mitarbeitende angewachsen. Was war der Treiber?
-
Da wir jetzt unsere eigenen Chefs waren, konnten wir einerseits schneller handeln als zuvor. Andererseits haben wir von der schwierigen Marktlage eher profitiert. Viele Grossunternehmen haben in dieser Zeit damit begonnen, ihre Lieferantenstruktur auf wenige strategische Partner zu reduzieren, und Elca war glücklicherweise meist gesetzt.
- Heute ist Elca über die Tochtergesellschaft SecuTix neben Vietnam in Spanien und Frankreich präsent. Wie verlief die Expansion ins Ausland?
-
Es führen drei Wege ins Ausland: Erstens, man beginnt bei Null. Zweitens, man expandiert für und mit einem Kunden. Oder drittens, man kauft sich über eine Akquisition in einen neuen Markt ein. Letzteres ist für ein Schweizer Unternehmen nur begrenzt möglich, da sich auf der Basis unseres kleinen Heimmarktes kaum eine Kriegskasse füllen lässt. Deshalb ist es auch so schwierig, mit Dienstleistungen im Ausland Fuss zu fassen. Man braucht schon ein Produkt, das darüber hinaus auch ein grosses Differenzierungsmerkmal aufweist.
- Hilft Swiss made dabei?
-
Per se nicht. Eher im Gegenteil. Swiss made impliziert ja automatisch auch, dass die Mitbewerber im Gastgeberland qualitativ nicht mithalten können. Dies wird auch als arrogant empfunden.
- Und trotzdem wirbt Elca mit Swissness?
-
Ich verbinde Swissness stark mit den Menschen, die bei uns arbeiten. Die Nähe zur EPFL und zu anderen Hochschulen macht letztlich die Qualität unseres Engineerings aus. Die Schweiz verfügt über hervorragende Ausbildungsmöglichkeiten. Auf dieses Pferd müssen wir setzen. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist die Tatsache, dass es uns gelingt, ganz unterschiedliche Nationalitäten und Kulturen zu integrieren. Wir haben aktuell 32 Nationen bei der ELCA Group. Sobald ich nach Frankreich und Deutschland gehe, zeigt sich ein ganz anderes Bild. Dort arbeiten meist nur Franzosen oder Deutsche. Selbst bin ich ja auch ein französischer Baske, der aber diesen schweizerischen Vorzug schätzen gelernt hat.
- Macht also das Multinationale Swissness aus?
-
Ja, das trifft es ziemlich genau. Aber wir müssen daran arbeiten, dass dies nicht nur so bleibt, sondern noch besser ausgespielt werden kann. Selbstverständlich sind andere traditionell schweizerische Tugenden wie Genauigkeit, Pünktlichkeit und Verlässlichkeit sicherlich kein Nachteil.
- So gesehen passt dann auch Vietnam zu Swissness.
-
Vietnam ist unsere verlängerte Werkbank. Wir arbeiten sehr integriert mit unseren Kollegen in Ho Chi Min City zusammen. Das heisst aber nicht, dass unsere Software nicht Swiss made ist. Denn das Know-how liegt nicht im Code. Die Programmierung ist ein extrem kleiner Teil einer ausgelieferten Lösung und strategisch gar nicht der wichtigste. Die Quintessenz unserer Dienstleistung liegt im Projektmanagement und reicht von der Definition der Anforderungen, der Festlegung der IT-Architektur sowie des Datenmodells bis hin zur Qualitätskontrolle.
- Die Softwareentwicklung hat sich ja auch enorm gewandelt.
-
Mit der Folge, dass das Code-Schreiben einen immer geringeren Anteil an der Wertschöpfung einnimmt. Embedded Software in den 70er Jahren hiess: wenig Funktionen, hohe Performance. Mit dem Wechsel zu den Informationssystemen wurde die Funktionalität immer komplexer. Der nichtfunktionale Teil hingegen verlor an Relevanz. Mit dem Web verändert sich das Paradigma erneut. Facebook und Google sind Realtime-Systeme, die von Millionen von Endkonsumenten gleichzeitig benutzt werden und sich dadurch auszeichnen, dass sie einen sehr hohen funktionalen Komplexitätsgrad aufweisen, aber auch im nichtfunktionalen Teil enorme Anforderungen stellen. Man muss sich also wieder sehr genau überlegen, wie die IT-Architektur auszusehen hat und wie man den Betrieb der Lösung sicherstellen kann. Damit verschiebt sich das Know-how in unserem Geschäft: Neben der Businessanalyse und der Datenmodellierung werden Themen wie Konfigurations- und Performance-Management sehr viel wichtiger.
- Warum ist es eigentlich so schwierig, aus der Schweiz heraus mit einem Softwareprodukt weltweit Erfolg zu haben?
-
Es fehlt das Ökosystem. Im Silicon Valley werden viele Start-ups gegründet, wovon es die wenigsten schaffen. Trotzdem verschwindet das Know-how nicht einfach. Es bleibt in den Köpfen der Leute und kann in einem anderen Zusammenhang wieder abgerufen werden. In der Schweiz muss man alles selbst machen und dabei viel Lehrgeld bezahlen. Dies haben wir auch mit SecuTix erfahren. Hätte ich mich auf ehemalige Mitarbeiter von Facebook, Google oder Amazon stützen können, wäre dies ganz anders. In den vergangenen Jahren hat sich jedoch schon einiges getan. Auch mit Secutix sind wir sehr erfolgreich und konnten 2013 mit der UEFA einen weiteren bedeutenden Kunden gewinnen.
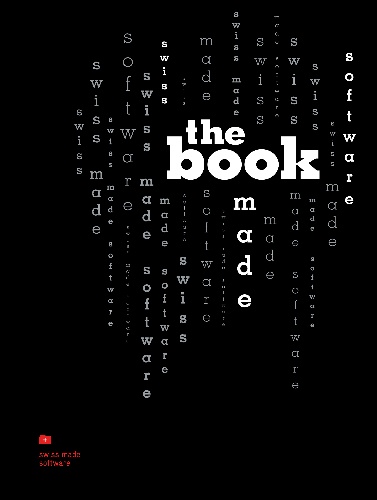
mehr davon...
...gibt es im neuen swiss-made-software-Buch "Public Innovation". Erhältlich als Print und eBook hier.
Weitere Artikel zum Thema Sicherheit
- Montag 23.02.2015
Die erfolgreiche Ausschreibung
Staatliche Softwarebeschaffungen dauern zu lange und sind deswegen häufig veraltet, bevor sie in Betrieb gehen, sie sind zu teuer – auch für viele Anbieter – und misslingen oft. Erfolgreiche Softwarebeschaffung trotz WTO-Korsett – ist das möglich? - Donnerstag 06.11.2014
Eine Kultur der Sicherheit
Die Enthüllungen zur NSA Spionageaffäre zeigen klar, das Datensicherheit neu gedacht werden muss. Davon kann nicht nur der Export Schweizer Sicherheitsprodukte profitieren, sondern auch die Einlagerung ausländischer Daten. - Montag 03.03.2014
Interview Laurent Haug «Menschen mit Ideen und Ideen mit Menschen verbinden»
Bekannt wurde Laurent Haug als Gründer der internationalen Lift-Konferenz. In diesem Interview spricht er über die Ursprünge seiner Idee, ihre weitere Entwicklung, seinen Abschied von Lift und über neue Projekte. - Montag 03.02.2014
Verbesserte IT Operations dank Echtzeitanalyse
Die Sammlung und Analyse von Endbenutzerdaten hat zunehmende Relevanz für IT-Themen wie Sicherheit, Service Management, Transformationsprojekte oder IT Governance. Nexthink verwandelt diese Daten in Echtzeit in aussagekräftige Informationen.