Die DNA von Swiss made software
Was sind die Stärken von Swiss made Software? Neben Schweizer Standortqualitäten und den allgemeinen Swissness-Tugenden wie Zuverlässigkeit, hohes Qualitätsbewusstsein und Fleiss ist Swiss made Software nicht zuletzt mit den permanent hohen Anforderungen ihrer Auftraggeber gewachsen.
 «Die hiesige Softwareindustrie ist im politischen Verteilkampf unter <ferner liefen> positioniert.» (©Klaus Leuschel)
«Die hiesige Softwareindustrie ist im politischen Verteilkampf unter <ferner liefen> positioniert.» (©Klaus Leuschel)
Warum gibt es keine Schweizer SAP, Oracle oder Microsoft? Was kann getan werden, damit die nächsten Google, Facebook oder Twitter aus der Schweiz kommen? Dies sind die Fragen, die Wirtschafts- und Innovationsförderer stellen müssen, wenn es darum geht, den hiesigen ICT-Start-up-Cluster auf die Startbahn zu schieben. Die Schweizer Softwareindustrie hat zwar gute Voraussetzungen, um auch tatsächlich abzuheben. Die Stratosphäre des Silicon Valley dürfte indes unerreicht bleiben. Dies aus einem einfachen Grund: Geschichte lässt sich nicht wiederholen, und die des Silicon Valley schon gar nicht.
Es ist denn auch ein spezieller historischer Mix, der zu einem derartig verdichteten Ökosystem südlich von San Francisco geführt hat: Auf einer Fläche von 4000 Quadratkilometern mit einer Wohnbevölkerung von 2,3 Millionen Menschen beschäftigen 7000 Unternehmen 500’000 Mitarbeitende und erzielen zusammen einen Umsatz von 200 Milliarden Dollar. Zum Vergleich: Das ICT-Berufsfeld in der Schweiz beschäftigt rund 176’000 Personen und erbringt eine Wertschöpfung von 28,1 Milliarden Franken.
Drei Generationen hat das Silicon Valley gebraucht, um dort zu sein, wo es heute ist. Die Initialzündung war ein Schockerlebnis: 1957 – das McCarthy-USA befindet sich mitten im kalten Krieg – gelang es der Sowjetunion, einen Satelliten in die Erdumlaufbahn zu schicken. Ein Ereignis, das am US-Selbstverständnis kratzte und zu einem riesigen Forschungs- und Investitionsschub führte, genährt durch jenen staatlich-militärischen Industriekomplex, der bis heute die US-Vormachtstellung begründet.
Viele dieser Forschungstätigkeiten wurden an den beiden kalifornischen Eliteuniversitäten Stanford und Berkeley angesiedelt. Von wo aus später manch durch die Rüstungsindustrie induzierte Errungenschaften der Informations- und Kommunikationstechnologien in eine zivile Nutzung überführt wurden. Ein prominentes Beispiel für einen solchen Werdegang ist ja nicht zuletzt das Internet.
Ein zusätzlicher Katalysator dieses Prozesses war die 68er-Bewegung. Als Epizentrum einer toleranten Lebenskultur zog die Bay Area bald Heerscharen von kreativen Freigeistern an. Aus dieser Babyboomer-Generation rekrutierten sich dann auch einige der bemerkenswertesten und erfolgreichsten IT-Unternehmer. Richtig explosiv wurde es Ende der 70er Jahre, als dieser «West Coast Way of Life» mit Wallstreet zusammenfand. Mit der Deregulierung und Entfesselung der Finanzbranche erlebte auch die Softwareindustrie einen Boom der seinesgleichen suchte und im Dotcom-Hype zu Beginn des neuen Jahrtausends seinen vorläufigen Höhepunkt erlangte.
Dass das Silicon Valley nach wie vor eine ungeheure Anziehungskraft auf Investoren ausübt, ist nicht weiter verwunderlich. Die Aussicht auf hohe Renditen ist weiterhin intakt. Spektakuläre Börsengänge sind zwar auch in den USA spärlicher geworden. Der Übernahmeappetit etablierter ICT-Unternehmen dagegen ist ungeschmälert. Diese verfügen denn auch über sehr tiefe Taschen. Von den geschätzt 2000 Milliarden Dollar an Vermögen, welche US-Unternehmen auf der hohen Kante liegen haben, schlummert ein Grossteil in der Kriegskasse der ICT-Multis. Kapital, das weitgehend dazu verwendet wird, sich am Start-up-Markt mit Innovationen einzudecken.
Immerhin darf sich die Schweizer Softwareindustrie rühmen, auch schon als Zulieferer gedient zu haben: So ging Day Software an Adobe, Google schnappte sich Endoxon, Media Streams wurde von Microsoft, Wuala von Lacie gekauft. Dies sind zweifellos Erfolge, welche Swiss made Software auf die globale ICT-Landkarte gebracht haben. Kein Wunder hat auch die Politik inzwischen den hiesigen ICT-Sektor als Wachstumstreiber entdeckt. Dennoch ist angesichts obiger Zahlen der Versuch, sich als Silicon Valley-Imitat zu profilieren, nicht nur falsch, sondern auch hochgradig lächerlich. Denn anders als Ende der 50er Jahre in den USA fehlt hierzulande jegliche Spur von einem Sputnik-Effekt.
Gefragt wäre der Staat nicht nur als Wirtschaftsförderer, sondern vor allem auch als Auftraggeber. Immerhin stammen geschätzte 30 Prozent des ICT-Marktvolumens aus den Töpfen der öffentlichen Hand. Leider werden diese – und damit ist die Schweiz nicht allein – selten dazu eingesetzt, um Innovationsthemen voranzutreiben. Gerade in den typischen Staatsbereichen wie Politik, Bildung oder Gesundheitsversorgung werden Informations- und Kommunikationstechnologien künftig eine eminent wichtige Rolle spielen. Zu wünschen wäre hierbei mehr Risikobereitschaft seitens der Behörden, eine Schrittmacherfunktion wahrzunehmen – nicht nur, aber vor allem auch in enger Zusammenarbeit mit der hiesigen Softwareindustrie.
Während ICT-Initiativen, Innovationsparks und Inkubatoren wie Pilze aus dem Boden schiessen, entpuppen sich die lokalen, kantonalen und nationalen staatlichen Behörden mitunter als zurückhaltender Kunde von Swiss made Software. Gemäss ICT-Präsident Thomas Flatt hat dies seinen historischen Grund: «In den 80er und 90er Jahren, als die Informatik in der öffentlichen Verwaltung Einzug hielt, gab es nun mal keine Schweizer Anbieter, die über die kritische Grösse verfügt hätten. Das ist heute anders, und ein Umdenken wird stattfinden müssen.»
Dass inzwischen eine potente nationale Anbieterschaft herangewachsen ist, zeigt eine Auswertung des Bundesamtes für Statistik aus dem Jahre 2008 deutlich: Nicht ganz die Hälfte aller rund 176’000 Beschäftigten im Schweizer ICT-Sektor arbeiten bei der Gruppe der Informatikdienstleister. Diese sind in der Regel KMUs und erbringen im allgemeinen Beratungs- und Entwicklungsdienstleistungen. Sie repräsentieren 70 Prozent der 11’000 ICT-Unternehmen in der Schweiz. Allein in den Jahren zwischen 2005 und 2008 hat diese Kategorie ihre Mitarbeiterzahl um 17 Prozent steigern können. Und das Wachstum dürfte – trotz Finanzkrise – auch in den vergangenen Jahren nicht nachgelassen haben.
 Die Regierungsbehörden sind noch zögerliche Kunden von Swiss made Software. (© Schlierner/Fotolia)
Die Regierungsbehörden sind noch zögerliche Kunden von Swiss made Software. (© Schlierner/Fotolia)
Die Kunden, welche für diesen Zuwachs gesorgt haben, finden die Informatikdienstleister inzwischen auch im Ausland. Auf rund drei Milliarden CHF wird derzeit die Exportleistung der Schweizer ICT-Branche kalkuliert. Auch wenn der Exportanteil in den vergangenen Jahren stetig gestiegen ist, lebt die Schweizer Softwareindustrie nach wie vor vorwiegend von der Binnennachfrage. Und damit von der Tatsache, dass Schweizer Unternehmen auch nach der Jahrtausendwende weiterhin stark in die Softwareentwicklung- und -dienstleistungen investiert haben.
Es ist also vor allem das potente und gegenüber ICT sehr aufgeschlossene Schweizer Unternehmenssubstrat das Swiss made Software voranbringt. Das Verhältnis ist aber auch reziprok: Schweizer Unternehmen sind nicht nur gute Kunden der hiesigen Informatikdienstleister, sondern umgekehrt ist Swiss made Software auch wichtiges Rückgrat für die Schweizer Wirtschaft. Durch den Einsatz von ICT kontinuierlich die Effizienz zu steigern und Prozesse zu optimieren, ist für Schweizer Unternehmen von eminent wichtiger Bedeutung. Denn nur so kann ein Hochlohnland wie die Schweiz seine Topposition in punkto Wettbewerbsfähigkeit halten.
Darin zeigt sich unverkennbar die DNA von Swiss made Software. Unternehmen wie Avaloq, Elca, aber auch eine E2E sind letztlich aus etablierten Unternehmen hervorgegangen. Andere haben ihre Lösung zu einem grossen Teil aus dem Projektgeschäft entwickelt und in engster Partnerschaft mit ihren Kunden über Jahrzehnte zu einem Produkt ausgebaut. Mit anderen Worten: Die Lösungen der Schweizer Softwareunternehmen sind in der Regel organisch herangewachsen.
Demgegenüber ist die kapitalgetriebene Inkubation innovativer Start-ups im Silicon Valley am ehesten mit der In-vitro-Fertilisation zu vergleichen. Die hohe Ausfallsquote ist einkalkuliert, und zwar nicht nur auf Seiten des Investors, sondern auch im Kopf des Entrepreneurs: Wenn es beim ersten Venture nicht funktioniert, dann halt beim zweiten, dritten oder vierten.
Ist ein Unternehmen dagegen auf Langfristigkeit und organisches Wachstum ausgelegt, lautet die Alternative: alles oder nichts. Und hat man als Unternehmen auf der Jagd nach dem Erfolg nur einen Schuss, verhält man sich automatisch auch konservativer. Entsprechend unaufgeschlossen zeigt man sich dann in der Regel auch gegenüber kostspieligen Experimenten unter Beteiligung von Fremdinvestoren.
Entrepreneurship, wie sie im Silicon Valley geprägt wurden, hat damit fast gar nichts zu tun mit dem Schweizer ICT-Unternehmertum. Die kulturellen Unterschiede sind denn auch frappant: So zwingt der knallharte Selektionsmechanismus Start-ups dazu, schon in einer frühen Phase Technologie wenn nicht an den Markt so doch an den Mann zu bringen. Im Valley lernt der Softwareingenieur von der Pike auf seine Visionen publikumswirksam in eine konkrete Businessidee zu verpacken und in ein kalkulierbares Geschäftsmodell (-risiko) zu giessen. Wer darin scheitert, hat keine Aussicht, je ins Reagenzglas zu kommen.
Demgegenüber versteht sich der Schweizer Ingenieursunternehmer traditionsgemäss als Elitehandwerker, der mit einem Toolset von Kompetenzen und Wissen antritt, um ein komplexes Problem zu lösen. Hierzu muss er weder Visionen entwickeln noch Begehrlichkeiten wecken. Qualität lautet sein oberstes Gebot. Dies ist zwar durchaus ehrenwert, führt aber auch zum hierzulande weit verbreiteten Syndrom, wonach sich gute Technologie von alleine verkaufen soll. Oder negativ formuliert: Das alles Marketing des Teufels ist. Dabei ist es gerade umgekehrt: Je genialer die Idee, umso grösser der Erklärungs- und damit der Kommunikationsbedarf.
Genau das Gleiche, einfach noch schneller und effizienter zu tun, ist zwar durchaus innovativ, führt aber nicht unweigerlich zu den Wachstumskurven, wie sie Investoren von Start-ups erwarten. Dazu braucht es den disruptiven Einsatz von Technologien – Ansätze und Konzepte also, die alles Vorangehende in Frage stellen. Dieses disruptive Moment zu managen und daraus die grösstmögliche Wertschöpfung zu erzielen, ist und bleibt denn auch das Privileg des Silicon Valley. Es ist gerade diese Kernkompetenz, die sich – ganz im Gegensatz zum Codecrack – nicht so einfach einfliegen lässt. Dieser Input wird allerdings matchentscheidend sein im weiteren qualitativen Wachstum von Swiss made Software: Man wird sich vermehrt global positionieren müssen, als Brutort für die Entwicklung von Weltklasse Software.
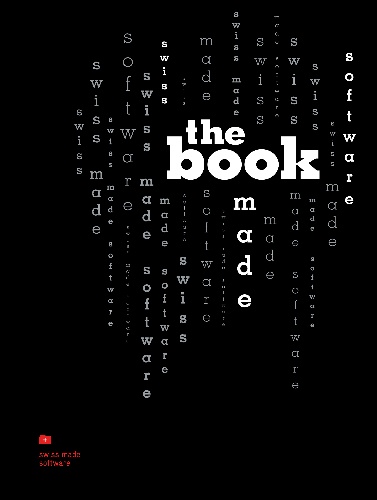
mehr davon...
...gibt es im neuen swiss-made-software-Buch "Public Innovation". Erhältlich als Print und eBook hier.