Interview Adrian Bult: "Reif für einen Entwicklungsschub"
Die einen haben die Innovation, die anderen die Kundenbeziehung: Kooperationen zwischen Start-ups und etablierten Anbietern ist der schnellste Weg, um den Schweizer Finanzplatz ins Fintech-Zeitalter zu führen.

- Thomas Brenzikofer: Ist Fintech mehr als nur eine Modeerscheinung?
-
Adrian Bult: Sowohl als auch. Zurzeit gibt es viel Aufruhr im Markt. Aber natürlich wird auch die Fintech-Bewegung wie letztlich alle technologischen Entwicklungen in Wellenform verlaufen. Festzustellen ist aber, dass derzeit viele Firmen von der Technologieseite her in den Finanzsektor eindringen. Und es wird viel Geld investiert. Deshalb können die etablierten Finanzinstitute das Thema nicht mehr länger ignorieren.
- Das klingt jetzt so, als wäre ICT für traditionelle Bankhäuser ein Fremdwort?
-
Nein, natürlich nicht. Bei Goldman Sachs ist jeder vierte Angestellte ein IT-Spezialist. Oder nehmen wir Swissquote in der Schweiz: Dort hat man schon vor Jahren im E-Private-Banking das gemacht, was heute unter dem Begriff Robo Advisors als absolute Revolution an die grosse Glocke gehängt wird. Innovation im Finanzsektor ist schon seit Jahrzehnten durch Informationstechnologie getrieben. Die Frage ist einfach, ob man sich damit hervortun möchte oder nicht. Ich bin überzeugt, dass es heute für ein traditionelles Bankhaus durchaus opportun ist, sich einen Fintech-Anstrich zu geben. Deshalb ist der Begriff auch in aller Munde.
- Also halbalter Wein in halbneuen Schläuchen?
-
Dies kann man bei jeder neuen Entwicklung behaupten, und bis zu einem gewissen Grad auch zurecht: Schliesslich wird das Rad selten ganz neu erfunden. Dennoch bin ich überzeugt, dass die Zeit heute reif ist für einen gröberen technologischen Entwicklungsschub in der Finanzwelt. Dies hat nicht zuletzt auch die Finma erkannt. So diskutiert man über eine Bankenlizenz «light», um eben der Innovation entgegenzukommen.
-
Was ist der Haupttreiber dieser Entwicklung?
-
Die Veränderung geschieht an der Kundenfront. Es kommt eine neue Generation von Kunden ins Banking-Alter. Diese ist mit der digitalen Welt aufgewachsen. Damit erscheint erstmals ein Menschentyp auf dem Markt, der in der Tendenz der Technologie und damit einem gesichtslosen Gegenüber ebenso vertraut wie einem Menschen. Genau dies war bislang beim E-Banking – aber auch in vielen Bereichen des E-Commerce – die Knacknuss. Wenn mir ein Robo Adviser die Anlagestrategie macht und die Transaktionen abwickelt, dann vertraue ich mich vollkommen den Algorithmen und damit einer Blackbox an.
- Stellt die Finanzwelt für Normalsterbliche nicht schon längst eine Blackbox dar?
-
Das mag sein. Aber Menschen trauen immer noch am ehesten anderen Menschen – zumindest in unserer Generation.
- Was würde denn eine Bankenlizenz «light» dem Schweizer Finanzplatz bringen?
-
Durch die Schaffung einer Lizenz, die es erlaubt, nicht nur das volle Bankenangebot, sondern bestimmte Teile davon zu betreiben, würde den Marktzugang für neue Anbieter erheblich erleichtern. Die Frage ist dann natürlich, von wo bis wo der Scope reicht und was sich damit genau machen lässt.
- Nachdem die Finanzindustrie jahrelang unter verschärften Regulatoren gelitten hat, soll der Markt jetzt einem Schwarm Venture-Capital-getriebener Mitbewerber geöffnet werden. Wäre das nicht diskriminierend?
-
Die Regulatorien sind nicht das einzige Problem der etablierten Banken. Vor allem die mittleren und kleineren Betriebe arbeiten auf einer viel zu hohen Kostenstruktur. Gerade durch die Finanzkrise wurde dies auf sehr drastisch Weise augenscheinlich. Fintech könnte für diese Anbieter ein probates Mittel sein, um mit neuen Geschäftsmodellen wieder an frühere Gewinnmargen anzuknüpfen.
- Bislang haben sich aber die etablierten Banken eher zurückgehalten. Die Schweiz gilt noch nicht als Fintech-Hub. Ist der Zug abgefahren?
-
Nein, es gibt noch viel Potenzial. Natürlich haben das Silicon Valley oder London die Nase vorn. Das ist aber auch eine Frage der Wahrnehmung. Nehmen Sie die App der UBS. Diese übertrifft vieles, was man derzeit auf dem Markt antrifft. Aber eben, es handelt sich halt nicht um ein Start-up, das zig Millionen VC-Funding erhalten hat und dies medial ausschlachten kann. Oder nehmen Sie Nutmeg: Wenn ich deren Angebote mit dem vergleiche, was heute schon bei Swissquote integriert ist, dann verstehe ich die Aufregung nicht.
- Das heisst, der Schweizer Finanzplatz werkelt einfach im Stillen vor sich hin, während andere alles an die grosse Glocke hängen. Real droht aber keine Gefahr?
-
Natürlich wird der Wettbewerb neu entfacht. Ich sehe jedoch nicht, warum die Schweizer Institute nicht auch von der technologischen Entwicklung profitieren sollen. Angefangen von der Blockchain-Technologie, über das Crowdfunding bis hin zum Peer-to-peer-Lending gibt es interessante und innovative Anwendungen. Diese müssen sich am Markt aber erst noch durchsetzen. Damit dies gelingt, ist und bleibt der Kontakt zum Kunden entscheidend. Gerade hierbei sind die etablierten Institute klar im Vorteil.
- Sie glauben also nicht daran, dass der Kundenberater schon bald durch Algorithmen ersetzt werden kann? Genau darauf setzt doch Fintech.
-
Nein. Aber ich glaube daran, dass der Bank- und Vermögensberater in Zukunft ganz anders arbeiten wird als heute und dabei völlig neue Werkzeuge einsetzen wird. Selbst in einer komplett digitalen Welt werden Menschen immer noch ein menschliches Gegenüber haben wollen, wenn es um tiefgreifende Entscheide geht. Und das betrifft Gesundheits- oder eben auch Geldfragen. Die Zukunft gehört deshalb meiner Meinung nach vor allem den Hybrid-Strategien.
- Etablierte Finanzinstitute als Vertriebspartner, Start-ups als Innovationstreiber – wäre dies das Erfolgsrezept des Fintech-Standortes Schweiz?
-
Ich glaube, das Verständnis, dass man nicht alles selber machen muss, greift mehr und mehr auch in der Schweizer Finanzbranche um sich. Aber auch umgekehrt braucht es ein Umdenken. Für Start-ups bringen etablierte Anbieter ein sehr wichtiges Asset mit: Die Kundenbeziehung. Nehmen Sie eine PostFinance oder eine Raiffeisen: Beide verfügen über einen äusserst feingranularen Vertriebskanal. Einen solchen baut man nicht über Nacht auf, da kann ein Start-up noch so gut finanziert sein. In einem trägen Massenmarkt – und das ist das Retailbanking-Geschäft letztlich – sind solche dezentralen Strukturen ein enormer Marktvorteil. Wenn sich jeder auf seine Stärken fokussiert, könnte die vertiefte Kooperation zwischen Start-ups und etablierten Anbietern tatsächlich ein Erfolgsrezept für die Schweiz sein. Das gilt ja nicht nur für den Finanzsektor; andere Wirtschafsbereiche wie etwa die Life Science machen dies schon länger vor.
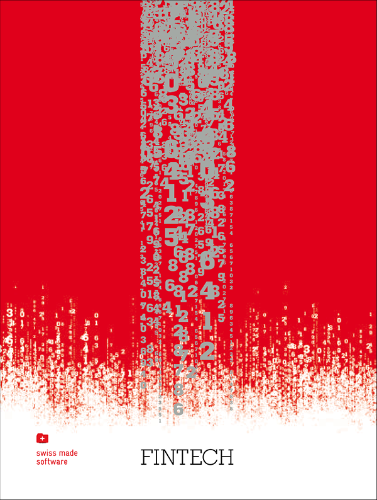
mehr davon...
..gibt es im neuen swiss-made-software-Buch "Fintech". Erhältlich als Print und eBook hier.