Interview Franz Grüter: "Der internationale Druck wird zunehmen"
Mit dem Vorschlag zum neuen Bundesgesetz betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs (Büpf) würde die Schweiz als sicherer Datenhafen in Frage gestellt. Doch für Franz Grüter, CEO von green.ch und SVP-Politiker, steht noch viel mehr auf dem Spiel.

- Thomas Brenzikofer: Das Data-Center-Geschäft soll in den vergangenen Jahren stark vom Post-Snowden-Effekt profitiert haben. Spüren Sie das?
-
Franz Grüter: Schweizer Firmen achten heute sehr genau darauf, wo die Rechner stehen, auf denen ihre kritischen Daten gespeichert sind. US-Kunden interessiert dies dagegen weniger.
- Eine andere Kultur?
-
Ja, die Aufmerksamkeit gegenüber diesem Thema ist in Europa und in der Schweiz sehr viel grösser. Allerdings steigt die Nachfrage nach Rechenzentren nicht erst seit den Enthüllungen von Edward Snowden. Vielmehr wächst das Datenvolumen – und zwar exponentiell. Die Unternehmen sehen, dass die Dateninfrastruktur für ihr Geschäft mehr und mehr kritisch ist. Deshalb wollen sie diese dort betreiben, wo sie sicher ist und keine Ausfälle riskieren. Diesbezüglich hat die Schweiz ganz klar einen Trumpf in der Hand. Mit Technologie hat dies aber vorderhand nichts zu tun. Was zählt, sind vielmehr die allgemeinpolitischen
Rahmenbedingungen.
- Diese Rahmenbedingungen werden nun aber durch das neue Büpf gefährdet?
-
Mein Engagement gegen das Büpf und damit den Ausbau der staatlichen Überwachung von Millionen unschuldiger Bürger ist in erster Linie politisch motiviert. Es geht um die Grundsatzfrage nach der Rolle des Staates. Ich habe grosse Bedenken, wenn über Bürger zu viele Daten erfasst werden.
- Unternehmerisch wäre also das Büpf zu verkraften?
-
Natürlich würde die neue Gesetzesordnung bei Unternehmen wie green.ch unsinnige Mehrkosten verursachen und unsere Wettbewerbsfähigkeit gegenüber dem Ausland in Frage stellen. Was mich aber im Innersten bewegt und auch auf die Barrikaden steigen lässt, ist letztlich die politische Überzeugung, dass das Büpf die Freiheitsrechte und die Privatsphäre der Bürger massiv einschränkt.
- Woher rührt denn Ihr Unbehagen?
-
Es ist paradox. Auf der einen Seite schützen Datenschützer die Privatsphäre des Bürgers sehr penibel, was auch viele neue Geschäftsmodelle rund um Big Data verunmöglicht. Auf der anderen Seite will der Staat Millionen von Daten auf Vorrat speichern.
- …und jede Menge Missbrauch betreiben?
-
Solange wir in einem demokratischen und stabilen politischen System leben,
wie dies derzeit der Fall ist, mag vieles weniger heikel erscheinen. Aber es gibt
leider keine Garantie dafür, dass das immer so bleibt. In Deutschland etwa wird sehr viel sensibler mit dieser Thematik umgegangen. Das hat natürlich historische Gründe. Nur zur Erinnerung: Der Satz «wer nichts zu verbergen hat, hat nichts zu befürchten», wie er mir in der «Arena» im Schweizer Fernsehen entgegengehalten wurde, stammt ursprünglich von Goebbels. Auch die Stasigeschichte ist immer noch in bester Erinnerung.
- Wie stark ist der freiheitliche Umgang mit dieser Thematik ein Innovationstreiber – oder im Gegenteil eben ein Innovationskiller?
-
Natürlich hat die Schweiz als Dateninsel einen Standortvorteil. Der Vergleich mit der Finanzindustrie hinkt aber auch. Wir sind kein Hort von halblegalen Daten. Im Gegensatz zu gewissen Bankkonti könnten diese Daten irgendwo untergebracht werden. Trotzdem sind derzeit 25 Prozent des europäischen Datenvolumens in der Schweiz gelagert. Schon möglich, dass wir damit mehr und mehr auf den Radar geraten. Aber: Es ist essenziell, dass die Schweiz hier nicht dem Druck nachgibt.
- Der Staat hat im Innovationsökosystem nicht nur eine entscheidende Rolle als Rahmenhüter und Regulator. Könnte er nicht auch eine aktivere Rolle spielen?
-
Ich finde, die Schweiz macht das schon sehr gut. Punkto Ausbildung und Universitäten spielen wir in der obersten Liga. Das Problem sehe ich bei der Finanzierung der Projekte. Aber ich glaube nicht, dass es Aufgabe des Staates ist, hier in die Bresche zu springen.
- Trotzdem, Innovationen brauchen Geld. Und dieses ist hierzulande ja eigentlich vorhanden, aber es fliesst nicht an den richtigen Ort.
-
Natürlich backen Start-ups hier sehr viel kleinere Brötchen als im Silicon Valley. Aber das ist vor allem eine Frage der Mentalität. Es braucht mehr Risikobereitschaft, und das heisst mehr Fehlertoleranz. Wer hierzulande scheitert, wird schnell einmal stigmatisiert, und wer Erfolg hat, dem wird dieser missgönnt.
- Und was kann die öffentliche Hand tun – Leute zum Unternehmertum umerziehen?
-
Nein, aber das richtige Umfeld schaffen. Innovationen beginnen im Kleinen. Deshalb sind Einrichtungen wie Technologieparks, Inkubatoren oder Akzeleratoren sehr wichtig. Und ganz wichtig: Wir brauchen genügend Fachkräfte.
- Die kommen allerdings mehr und mehr aus dem Ausland. Als SVP-Politiker wollen Sie hier sicher nicht der Immigration das Wort reden?
-
Wir sind nicht gegen die Zuwanderung, sondern für die richtige Zuwanderung. Unser Problem ist, dass jeder aus dem EU-Raum zu uns kommen kann. Was wir in der Schweiz aber brauchen, sind die besten Leute aus der ganzen Welt – egal ob Amerikaner, Chinesen oder Inder. Genau diese Leute werden aber diskriminiert behandelt. Im Silicon Valley spielt es keine Rolle, woher ein Spezialist kommt. Die Firma, die ihn anstellen möchte, bezahlt für den Visumantrag einfach mal 6000 Dollar. Dabei werden zwei Drittel der Anträge abgelehnt. Da überlegt man es sich als Start-up ganz genau, ob man den Antrag stellen möchte. Andererseits ist damit sichergestellt, dass nur die besten ins Land gelassen werden.
- Darüber hinaus betreibt aber die USA im Technologiebereich eine dezidierte Wirtschaftspolitik, und dies mit sehr viel Staatsgeld. Müsste die Schweiz nicht auch aktiver werden?
-
In den USA geschieht dies über ein Netz von staatlichen Agenturen, Universitäten, Unternehmen und Investoren. Darin sind die USA sehr erfolgreich. Der Staat ist eine Art Financier und Facilitator. Ein Modell, das sicher interessant ist und letztlich auch in der Schweiz verfolgt wird, allerdings auf sehr viel tieferem Niveau. Wenn der Staat die Eckparameter definiert, um die herum sich dann eine Industrie auf Privatinitiative entwickelt, ist das sicher nicht verkehrt. Wogegen ich mich wehre, ist das Modell, wie es in China oder auch zum Teil in Frankreich praktiziert wird: Dort übernimmt der Staat gleich alle Funktionen und verzerrt über seine staatseigenen Betriebe sowie Protektionismus den Markt.
- Staat, bleib bei deinen Leisten?
-
Alles im Allem machen wir in der Schweiz doch vieles richtig. Zum Teil sind wir halt auch Opfer des Erfolges. Wenn der Erfolg unserer Wirtschaft dazu führt, dass junge Leute schon ab der Universität bald einmal 150'000 Franken verdienen, ist das hervorragend für die Kaufkraft. Aber eben, warum sollte man dann den steinigen Weg begehen und sein eigenes Ding wagen?
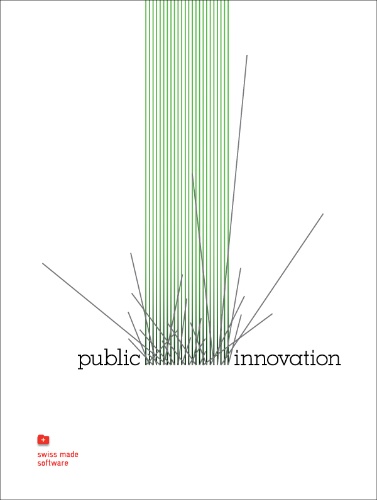
mehr davon...
...gibt es im neuen swiss-made-software-Buch "Public Innovation". Erhältlich als Print und eBook hier.