Wenn der Staat zum Softwareanbieter mutiert
Die Geschichte um die Gerichtssoftware Open Justitia zeigt: Ein verwaltungsinterner Austausch von Software macht mehr Sinn als eine Veröffentlichung unter Open-Source-Lizenz.
 Göttin Justitia soll für Gerechtigkeit sorgen.
Göttin Justitia soll für Gerechtigkeit sorgen.
Wie weit darf der Staat in die Privatwirtschaft eingreifen? Darf die Verwaltung eine Software kommerziell vertreiben und damit bestehende Privatunternehmen konkurrenzieren? Um diese Fragen dreht sich die Auseinandersetzung um die Gerichtssoftware Open Justitia.
Zwei Gerichte im Streit
Die Geschichte beginnt Anfang 2007. Das damals neu entstandene Bundesverwaltungsgericht wird an die IT des Bundesgerichts angeschlossen. Seit der Jahrtausendwende fährt das oberste Gericht eine konsequente Open-Source-Strategie – das neue Gericht findet sich damit aber überhaupt nicht zurecht. Nach einem jahrelangen Streit migriert das Bundesverwaltungsgericht schliesslich Anfang 2011 auf eine Microsoft-Umgebung. Parallel zum Streit um die Bürosoftware geht es auch um die Frage, ob das Bundesverwaltungsgericht die Gerichtssoftware des Lausanner Bundesgerichts verwenden sollte. Das oberste Gericht stellt sich auf den Standpunkt, das Bundesverwaltungsgericht solle entweder alles oder nichts übernehmen. Da dieses aber partout keine Open-Source-Bürosoftware will, kommt es auch bei der Gerichtssoftware zu einer Trennung – obwohl das neue Gericht eine Kooperation bei der Fachanwendung wünscht.
So entschied sich das Bundesverwaltungsgericht Anfang 2010 für eine Zusammenarbeit mit Abraxas und Weblaw. Für das Bundesgericht ein Affront, denn Weblaw hatte zuvor bei zwei Projekten in Lausanne mitgearbeitet. Die Zusammenarbeit mit dem Berner Softwarehersteller wird daraufhin per sofort sistiert – weil das Bundesgericht befürchtete, Weblaw würde Know-how zum Bundesverwaltungsgericht transferieren, sagt Weblaw. Weil die Qualität der Entwicklungen nicht den Erwartungen entsprach, sagt das Bundesgericht.
Jedenfalls entschloss sich das Bundesgericht daraufhin, seine Software selbstständig den eigenen Bedürfnissen anzupassen, weil seiner Meinung nach auf dem Markt kein geeignetes Produkt erhältlich war. Weblaw sagt heute, dieser Entscheid habe dazu geführt, dass man Arbeiten dreifach ausgeführt habe. Weblaw-Inhaber Franz Kummer: «Wir haben für das Bundesgericht das Produkt BLight realisiert. Diese Lösung musste für das Bundesverwaltungsgericht nochmals realisiert werden, weil das Bundesgericht den Code nicht freigegeben hat. Danach hat das Bundesgericht BLight nochmals intern realisiert.» Als das Bundesgericht 2011 begann, die selbst realisierte Software Open Justitia diversen Kantonen kostenlos anzubieten, ging Weblaw auf die Barrikaden. Der Vorwurf: Das Bundesgericht greife in die Privatwirtschaft ein und verzerre den Markt mit einer Gratislösung. Politiker, Fachleute und Aufsichtsgremien äusserten sich in der Folge zu dem Fall. Die einen wollen den Staat in die Schranken weisen und ihm jegliche Einmischung in die Privatwirtschaft untersagen. Die anderen argumentieren, man solle eine Software, deren Entwicklung der Steuerzahler sowieso schon bezahlt habe, doch bitteschön anderen Kantonsgerichten anbieten.
 Hier ist Open Source unerwünscht: Das Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen.
Hier ist Open Source unerwünscht: Das Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen. © Schweizerisches Bundesverwaltungsgericht, St. Gallen
Closed Community statt Open Source
Die Frage, ob die Verwaltung grundsätzlich Open-Source-Software veröffentlichen und verbreiten darf, ist nicht so einfach zu beantworten. In Bezug auf Open Justitia wird die Sache aber klarer.Ein im Oktober veröffentlichtes Rechtsgutachten kommt zum Schluss, dass keine gesetzliche Grundlage für die allgemeine Freigabe von Open Justitia besteht. Eine Open-Source-Software erscheine nicht erforderlich, wenn Bundesstellen selbst entwickelte Software mit anderen staatlichen Organisationen teilen möchten, heisst es darin. Als problematisch wird bezeichnet, dass das oberste Gericht gewissen Nutzern der Software technische Unterstützung anbiete. Eine weitere Verbreitung von Open Justitia findet seitdem nicht mehr statt.
Keine gesetzliche Grundlage braucht es laut Gutachtern hingegen, wenn man den Weg einer Closed Community wählt. Damit ist der staatsinterne Austausch von Software und Quellcode ohne Einbezug von Privatfirmen oder Kantonen gemeint. Eine solche Community würde es Bundesstellen erlauben, ihre selbst entwickelte Software mit anderen staatlichen Organisationen zu teilen.
Es stelle sich die Frage, schreiben die Gutachter, ob sich die Mehrheit der Zielsetzungen, welche mit Open-Source-Software in Verbindung gebracht werden, nicht auch auf diesem verhältnismässigeren Weg erreichen liesse. Ein zusätzlicher Vorteil einer solchen Closed Community besteht darin, dass sich die Aufgaben- und Kostenteilung unter den Beteiligten besser regeln lässt.
Ob die Closed Community in jedem Fall der richtige Weg ist, sei dahingestellt. Die Frage, ob der Staat mit eigener Software am Markt auftreten darf und wenn ja, auf welche Art und Weise, wird weiterhin für Diskussionsstoff sorgen.
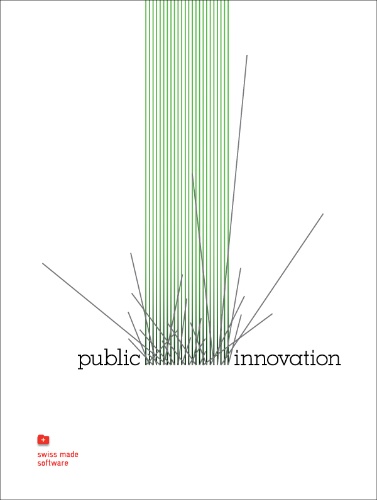
mehr davon...
...gibt es im neuen swiss-made-software-Buch "Public Innovation". Erhältlich als Print und eBook hier.